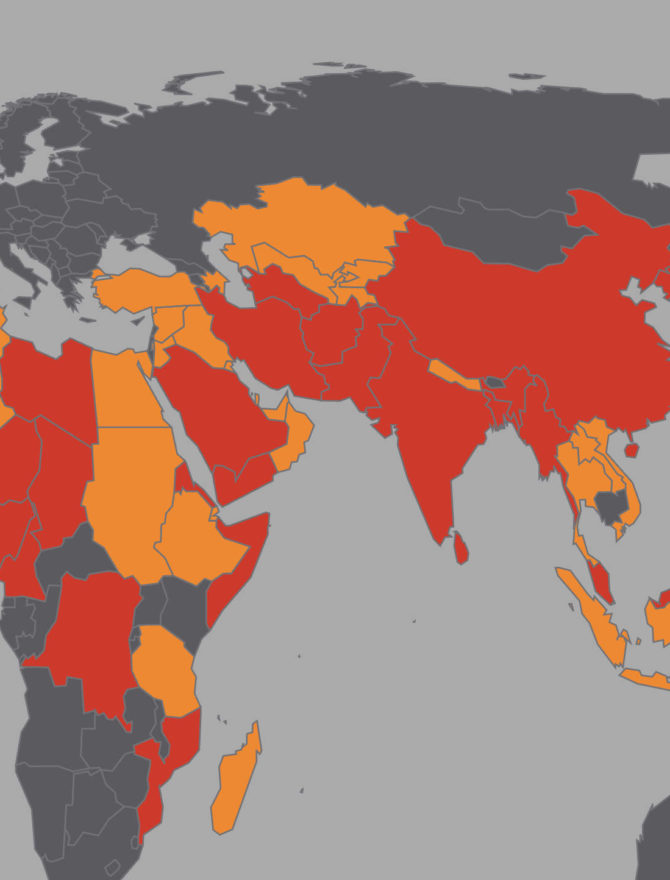Vor Ort · Interview mit Diakon Nwachukwu in Weimar
„Christenverfolgung ist Realität in Nigeria“!
von Samuel Bittner · 06.11.2025

Credo: Ikenna, in Nigeria wärst du nicht erst nächstes Jahr, sondern schon vor ein paar Jahren zum Priester geweiht worden. Was war dein tieferes Bekenntnis, das dich damals dazu bewogen hat, nach Deutschland zu kommen?
Diakon Ikenna Nwachukwu: Das stimmt. In Nigeria wäre ich schon vor drei Jahren zum Priester geweiht worden. Aber bei der priesterlichen Berufung geht es nicht darum, wo man am schnellsten Priester wird, sondern wohin Gott einen sendet. Es war keine willkürliche Entscheidung, damals nach Deutschland zu kommen. Ich hätte auch andere Möglichkeiten gehabt.
Jedoch hat mich die Situation der Diaspora im Bistum Erfurt tief bewegt. Ich wollte in einem Umfeld wirken, in dem der Glaube nicht selbstverständlich ist. Denn ich möchte Menschen näher zu Gott führen und ihnen die Freude am Glauben schenken. So bin ich nach Deutschland gekommen.
Credo: Warum treten in Nigeria Hunderte ins Priesterseminar ein, während es in Deutschland nur wenige sind?
Nwachukwu: In Deutschland wird der Glaube eher als private Angelenheit verstanden. Eltern sagen beispielsweise: „Wir lassen das Kind selbst entscheiden, ob es in die Kirche gehen möchte oder nicht.” Die Eltern in Nigeria säen diesen Samen des Glaubens dagegen schon früh in uns hinein. Wir wachsen mit diesem Glauben auf und kommen so irgendwann an einen Punkt im Leben, an dem wir uns die Frage nach unserer Berufung stellen. Deshalb treten viele ins Priesterseminar ein, auch wenn nicht alle bis zum Ende dortbleiben.

Credo: In deiner Heimat werden Christen von islamistischen Terrormilizen wie der Boko Haram wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt. Haben Menschen in deinem Umfeld direkte Erfahrungen damit gemacht? Wie sind sie damit umgegangen?
Nwachukwu: Im Norden Nigerias ist es Realität, dass Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ich selbst bin im Westen des Landes, in Lagos, geboren. Trotzdem habe ich Menschen kennengelernt, die das erlebt haben und dadurch Familienangehörige verloren haben. Für diese Menschen ist das Christentum keine Religion der Bequemlichkeit mehr. Glauben bedeutet für sie, auch dann weiterzugehen, selbst wenn es ihnen schlecht geht.
Sie sind sogar bereit, für ihren Glauben zu sterben. Sie nehmen sich ein Beispiel an den Aposteln, die ebenfalls für ihren Glauben verfolgt wurden. Das gibt ihnen täglich Kraft, ihr Leben zu bewältigen. Ich kenne einen Priester, der als Seminarist entführt wurde. Für ihn war das eine sehr traumatische Erfahrung – und doch ist er nicht aus dem Priesterseminar ausgetreten. Vielmehr war das wie „Benzin für seine Maschine“. Noch heute spürt man bei ihm die Freude am Glauben.
Credo: Manche Menschen folgen den Extremisten, weil sie ihnen einen Weg aus der Armut versprechen. Welche Antwort kann die Kirche diesen Menschen stattdessen geben?
Nwachukwu: Zunächst ist festzuhalten, dass der Hauptantrieb für den Beitritt zu terroristischen Zellen überwiegend religiös motiviert ist und dass eine Mitgliedschaft mitunter großzügig belohnt wird. Generell lässt sich Armut nicht wegpredigen – das sage ich immer wieder. Im Norden Nigerias gibt es zahlreiche kirchliche Einrichtungen, die armen Witwen helfen oder Frauen ermutigen, selbst aktiv zu werden. Nur so kann man Armut und auch diese Ideologien bekämpfen. Und das tut die Kirche im Norden sehr viel und sehr gut. Die Menschen erleben, dass es etwas Besseres gibt – und das führt sie weg von diesen Bewegungen.

Credo: Versuchst du das, was in der Pastoral in Nigeria gut funktioniert, hier umzusetzen? Oder braucht es im Osten Deutschlands ganz andere Lösungen?
Nwachukwu: Ich kann die Methoden aus Nigeria in Deutschland nicht eins zu eins umsetzen. Die Menschen hier sind einfach anders. Für viele ist der Glaube, wie bereits erwähnt, etwas sehr Privates. Trotzdem kann ich versuchen, meine Freude am Glauben zu zeigen – etwa indem ich in der Kirche lächle und Humor in meine Predigten einbaue. Die Leute – wie in Nigeria – auf die Straße zu schicken, um zu evangelisieren, passt jedoch nicht zur deutschen Kultur. Hier besuchen wir stattdessen im Rahmen der Caritas eher die Senioren im Altersheim, wenn sie Geburtstag haben.
In der Gemeinde gibt es außerdem wöchentlich einen „Mutter-Vater-Kind-Kreis“, an dem auch Menschen teilnehmen, die nicht katholisch sind. Ich mache vor allem Angebote und versuche, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Heute ist es nicht mehr dieses „von oben nach unten“, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg. „Syn-hodos“ – das ist mein pastoraler Ansatz hier in Weimar.
Credo: Du wirst im nächsten Jahr zum Priester geweiht. Es gibt viele Priester in Deutschland, die sehr enthusiastisch beginnen, aber nach einigen Jahren, nicht diese Aufbrüche erleben, die sie sich gewünscht haben. Was tust du konkret, um dein Feuer für Christus am Brennen zu halten – unabhängig von „missionarischen Erfolgen”?
Nwachukwu: Letztendlich wird meine Arbeit nur von einer Person bewertet: von Gott allein. Wenn ich am Ende meines Lebens vor ihm stehe, hoffe ich, dass er zu mir sagt: „Du hast das gut gemacht.“ Ich versuche als Mensch mein Bestes zu geben. Und diese Arbeit wird nicht leichter. Ich habe schwierige Momente, die ich im letzten nur durch mein geistliches Leben bewältigen kann.
Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus im Gebet, das ist mein Feuer hier! Ich setze das niemals aufs Spiel und versuche diese Beziehung ständig zu verbessern. Wenn ich meine Berufung jedoch nur als administrative Tätigkeit sehe und vergesse, dass ich für die Menschen geweiht worden bin, dann kann dieses Feuer erlischt werden. Denn Jesus ist der Gipfel und die Quelle von allem!