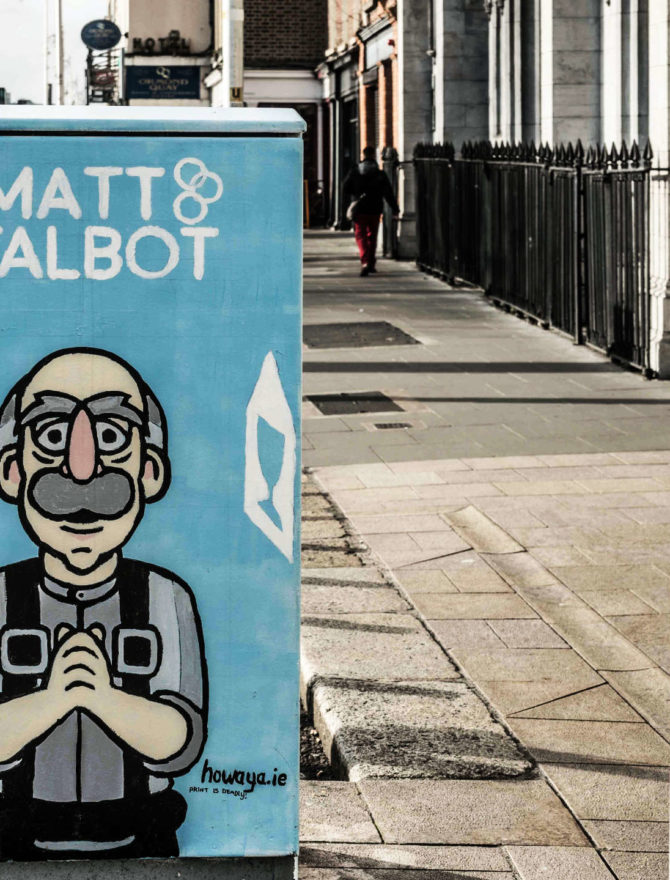Thema · Leitartikel
Veränderung bedeutet Bereitschaft zum Risiko – für Gott
von Prof. Dr. Peter Schallenberg · 16.06.2021

Veränderung hat zu tun mit „change“: Wechsel, wandeln, wenden. Das kommt vom indogermanischen Sanskrit-Wort „skambos“ („cambio“ nennt sich noch heute auf Italienisch der Geldwechsel) und heißt so viel wie: umdrehen, den Weg oder die Richtung verändern. Da fällt mir als erstes das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium ein: Nachdem er das Vaterhaus verlassen und all sein Geld durchgebracht hatte, landete er bei den Schweinen. Und dort, im tiefsten Elend, als Mensch mutterseelenallein bei den Tieren, geht ihm auf einmal auf: Du Idiot! Wie vielen Tagelöhnern im Vaterhaus geht es besser als dir! Wie kommt er darauf? Weil er spürt: Ich überlebe zwar knapp und haarscharf, aber ich lebe nicht mehr wirklich, ich bin in Wirklichkeit längst bei lebendigem Leib verstorben, ich vegetiere nur noch vor mich hin.
Das Gleichnis sagt: „Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon.“ (Lk 15,16) Das ist der eigentliche Tod, der zu fürchten ist, und die eigentliche Katastrophe des Menschen: zu überleben, nicht äußerlich zu verhungern, aber innerlich längst einsam verhungert zu sein, weil niemand mir etwas gibt! Weil man sich im Zweifelsfall alles nehmen muss, manchmal sogar mit Gewalt. Weil niemand da ist, der mich als Mensch mit Liebe behandelt, stattdessen viele, die mich wie ein zahmes Nutztier behandeln, das bei guter Fütterung Ertrag abwirft …

Lebe ich unter meinen Verhältnissen?
Der verlorene Sohn erkennt das erschüttert und kehrt um, verändert Richtung und Weg seines Lebens, kehrt zurück zum Ursprung seines Lebens, zur Liebe des Vaters. Nur weg von den Schweinen, nur weg von Kosten-Nutzen-Rechnungen! Antoine de Saint-Exupéry schreibt einmal in einem seiner letzten Briefe vor dem Flugzeugabsturz: „Man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es nicht mehr.“ (A. de Saint-Exupéry, Dem Leben einen Sinn geben) Das ist exakt die Erkenntnis des verlorenen Sohnes, die Erkenntnis des Zachäus ebenfalls im Lukas-Evangelium, die Erkenntnis so vieler Christen und Heiliger: Ich muss mich ändern und verändern und bekehren. Hinkehren zum Licht und umkehren zur Quelle des Lebens.
Und daraus erwächst die tägliche Frage: Lebe ich heimlich still und leise schon große Teile meines Tages, meines Lebens bei den Schweinen, bei den Futterschoten, bei den Fleischtöpfen, gut genährt aber innerlich leer und hungrig? Habe ich gar meinen Frieden gemacht mit den kleinen und größeren Schweinen meines Lebens, mit dem Zeittotschlagen und dem Zeitvertreib, mit den Lieblosigkeiten und Oberflächlichkeiten, mit dem scheinbar normalen Leben in allzu gewohnter Durchschnittlichkeit? Lebe ich unter meinen Verhältnissen und unter dem Niveau, das Gott eigentlich für mich vorgesehen und für das er mich berufen hat?
Denn das ist ja das Gefährliche am Leben in der gewohnten Schweinerei: Man gewöhnt sich dran und hält es auf Dauer für normal. Man sieht nicht mehr die Möglichkeiten zur besseren Veränderung und zu neuem Aufbruch und zu ungewohnter Heiligkeit. Der englische Philosoph John Stuart Mill notiert einmal bitter: „Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein.“ (John Stuart Mill, Der Utilitarismus)

Gott hat das Recht, mehr als Durchschnitt zu erwarten
Ja, die Angst vor Veränderung und Unglück und Scheitern kann lähmen und lässt erstarren. Man muss mutig sein, wenn man Veränderung riskiert. Man braucht Demut und Bereitschaft zum Risiko. Der verlorene Sohn wusste nicht, wie der Vater ihn aufnehmen würde. Zachäus wusste nicht, ob Jesus bei ihm zu Gast sein wollte. Wer zu einem anderen Menschen sagt „Ich liebe dich“, weiß nicht, wie die Antwort ausfällt und ob die Enttäuschung groß sein wird. Wir wissen nicht im Voraus, ob sich unser Leben lohnt, wenn wir alles auf eine Karte setzen, wenn wir ganz auf Gott und seine Vorsehung vertrauen, wenn wir verzichten auf vieles, um die größere Liebe zu leben.
Auch die Heiligen hatten diese Ängste und Unsicherheiten. Schon Petrus sagt zu Jesus in fast rührender Ängstlichkeit: „Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.“ (Mk 10,28) Was werden die Jünger dafür erhalten? Aber Paulus ermahnt sich und uns: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht.“ (Röm 8,28) Was für ein kraftvolles, ein herrliches Wort! Nicht ängstlich auf die Bilanz des Lebens starren müssen, nicht schmallippig das eigene Schäfchen ins Trockene bringen wollen, nein: großmütig und großzügig auf den schauen, der all unsere größere Liebe verdient. Auf Gott. Und der das Recht hat, von uns mehr und Größeres zu erwarten als die durchschnittliche Begabung zur korrekten Buchhaltung. Der von uns erwartet: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)

Mut zum steinigeren Weg
Von solcher Erwartung, ja von solcher Zumutung Gottes geht eine schier grenzenlose Dynamik der Veränderung aus. Ein Leben lang gilt nämlich: Noch ist nicht aller Tage Abend, noch ist keine Zeit, die Hände in den Schoß zu legen, noch ist Tageslicht und Lebenslicht genug zur Veränderung und zur Wahrnehmung der Schweine und zur entschlossenen Veränderung des eigenen Lebens.
Denn das genau will Gott von uns: Mut zur Heiligkeit, zur größeren Liebe, zum steinigeren Weg, zur ermüdenden Mühe. Das kann und wird dann auch durch Schatten und Dunkelheit und Nacht führen, wie beim hl. Johannes vom Kreuz oder der kleinen hl. Theresia. Aber auch hier gilt das andere Wort des hl. Paulus: „Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist.“ (Phil 3,13)
Und das gilt zuletzt sogar vor der äußersten Grenze, dem Tod. Dem eigenen Tod und dem Tod geliebter Menschen. Dies erst ist der letzte und bitterste Lackmus-Test unseres Glaubens: Glauben wir, dass Gott uns erwartet durch die Todesangst hindurch und am Ende in der Vollendung unseres irdischen Lebens? Zurückblickend werden wir dann, aber erst dann, mit Sicherheit wissen: Es war sehr gut, dass wir gelebt haben, dass wir leben durften, dass Gott uns Veränderung und Verwandlung zumutete. Es war sehr gut, weil es nötig war, um so zu werden, wie Gott uns gemeint hatte. Wer das erkannt haben wird, für den ist die ganze Seligkeit angebrochen.